Artikel
Artikel
Die USA verzeichneten in den vergangenen Jahrzehnten starke Handelsbilanzdefizite. Eine wesentliche Ursache dieser Defizite ist die grosse Nachfrage der Welt nach US-Staatsanleihen. Diese Nachfrage wertet den Dollar auf und senkt in den USA die Zinsen, was Importe von ausländischen Waren verbilligt und damit zum Handelsbilanzdefizit beiträgt. Die globale Nachfrage nach US-Assets wird häufig als «Exorbitantes Privileg» bezeichnet, weil es den USA erlaubt, sich zu günstigen Bedingungen gegenüber dem Rest der Welt zu verschulden.
Ziel der Trump’schen Politik ist es, das Handelsdefizit zu reduzieren, und dies vor allem mit Zöllen auf importierte Waren. Die Idee ist, ausländische Güter zu verteuern, und damit die Produktion von Gütern ins Inland zu verlegen. Die Einführung der US-Zölle, vermutlich aufgrund der erratischen Art und Weise, wie dies geschah, und der damit verbundenen grossen Unsicherheit, führte zudem zu einer Flucht von Investoren aus dem US-Dollar: Der Dollar wertete ab, und die Zinsen in den USA zogen an. Dieser indirekte Effekt – das Erodieren des Exorbitanten Privilegs – könnte ebenso dazu beitragen, das US-Handelsdefizit zu reduzieren.
Aber gibt es gute ökonomische Gründe, dass eine Reduktion des Handelsdefizits für die USA überhaupt wünschenswert wäre? In einer aktuellen Studie zeigen wir, dass das Exorbitante Privileg und die damit verbundenen Handelsdefizite tatsächlich zu Wohlfahrtsverlusten in den USA führen können. Wir argumentieren, dass die niedrigen Zinsen vor allem den privaten Konsum erhöhen. Im Sektor für nicht handelbare Güter (zum Beispiel die meisten Dienstleistungen und im Bauwesen) führt die gestiegene Nachfrage zu höheren Preisen und damit auch Löhnen. Die höheren Löhne wiederum reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen im handelbaren Sektor (zum Beispiel in der Fertigungsindustrie), so dass diese Firmen schrumpfen. Investitionen und Produktivitätswachstum allerdings sind hauptsächlich im handelbaren Sektor konzentriert. Das Schrumpfen der Firmen in diesem Sektor bedingt also geringere Investitionen, und das Wachstum stagniert. Dieser negative Wachstumsimpuls kann stark genug sein, das Exorbitante Privileg in eine «Exorbitante Belastung» zu verkehren, so dass die Handelsbilanzdefizite tatsächlich eine geringere Wohlfahrt widerspiegeln.
Doch impliziert dies, dass Zölle und die damit verbundene Reduktion der Handelsdefizite und die Flucht aus dem Dollar die Wohlfahrt wieder erhöhen? Die Antwort ist nein. Unser ökonomisches Modell zeigt, dass die Einführung von Zöllen das Handelsdefizit zwar reduziert, gleichzeitig das Produktivitätswachstum aber noch weiter senkt. Grund ist der, dass sich die Investitionen der Firmen im handelbaren Sektor auf mehr Produkte verteilen, wenn nun alles im Inland hergestellt werden will. Dies reduziert die Effizienz von Investitionen und damit das Produktivitätswachstum, was die Wohlfahrt in den USA noch weiter senkt. Eine erfolgreiche Reduktion des Handelsdefizits und eine Flucht aus dem Dollar wären also ein Pyrrhussieg, da sie die US-Wirtschaft nicht wie erhofft beleben.
Eine zielgerichtetere und damit effektivere Politik als die Einführung von Zöllen wäre es, die billigen Zuflüsse von Kapital in die USA zu nutzen, um sie in die richtigen Sektoren umzulenken. Als Beispiel diskutieren wir die Schaffung von Investitionsanreizen für Unternehmen im handelbaren Sektor. Dies ist ein natürlicher Ansatz, da die Wohlfahrtsverluste der Handelsbilanzdefizite gerade aus den zu geringen Investitionen der Firmen in diesem Sektor resultieren. Diese Politik würde die billigen Zuflüsse von Kapital umlenken, weg von Konsum und hin zu mehr Investitionen. Die Handelsbilanzdefizite würden nicht verschwinden, aber sie wären nun, zumindest zum Teil, Ausdruck von importierten Investitionsgütern und von robustem Wachstum.
Schliesslich sind diese Investitionsanreize am billigsten zu finanzieren, wenn die globale Nachfrage nach Dollar stabil bleibt und die Zinsen in den USA niedrig sind, vor allem die Zinsen auf die Staatsverschuldung. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine erratische Zollpolitik, welche die Nachfrage nach Dollar untergräbt, die Zinsen erhöht und eine Finanzierung von Investitionsanreizen erschwert, also eine doppelt schlechte Politik für die USA.
Und der Rest der Welt? Dieser profitiert ebenso von niedrigen US-Zöllen sowie robustem Produktivitätswachstum in den USA, letzteres zum Beispiel über mehr Wissenstransfers, welche das Produktivitätswachstum auch in anderen Teilen der Welt erhöhen.
Bild: Adobe Stock / leungchopan
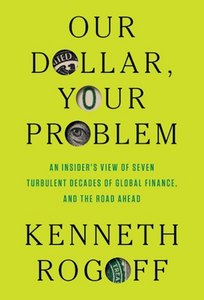
Buch
Harvard Professor Kenneth Rogoff zeigt, dass der Niedergang des Dollars schon vor Trump begonnen hat.

Podcast
Ein Namensvetter. Aber dieser Martin Wolf ist ‘Chief Economics Commentator’ bei der Financial Times. Er spricht mit Kenneth Rogoff über Donald Trumps Handelspolitik, die Zukunft des Dollars und was das für andere Währungen bedeutet.