Artikel
Artikel
Die Demokratie unterscheidet sich von allen anderen Herrschaftsformen darin, dass sie den öffentlichen Streit als Voraussetzung guter Entscheidungen begrüsst. Überall sonst, von der Monarchie über die Aristokratie bis zur Diktatur, gilt das Gegenteil: Öffentlich ausgetragener Streit, sei es unter den Herrschern oder den Beherrschten, bedroht das System. Die Streitfreude konnte aber nur ein Alleinstellungsmerkmal der Demokratie werden, weil ein umfassendes Regelwerk dafür sorgt, dass die politische Auseinandersetzung in friedlichen und geordneten Bahnen verläuft. Die Verlierer von heute können die Sieger von morgen sein. Streit ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zur Herbeiführung von Mehrheitsentscheiden, die von allen Beteiligten akzeptiert werden. Damit wird dem Ringen ein vorläufiges Ende gesetzt, bis es für einen anderen Entscheid von Neuem losgeht. Mehrheiten entscheiden nicht nur, was getan wird, sondern auch, wer an die Macht kommt. Für den Fortbestand der Demokratie ist das Versprechen zentral, dass sich Mehrheiten immer wieder neu bilden und niemand mit der Aussicht leben muss, für immer in der Minderheit zu verbleiben. Der geordnete Machtwechsel durch neue Mehrheiten ist die Lebensgrundlage jeder Demokratie.
Damit das demokratische Regelwerk funktioniert, braucht es Institutionen mit unterschiedlichen Aufgaben, die sich gegenseitig kontrollieren, kritisieren und respektieren – von der Regierung über das Parlament und die Gerichte bis zu den Medien. Demokratische Herrschaft beruht auf Machtkontrolle und Machtteilung. Wer sich politisch engagiert, muss nicht nur gut verlieren, sondern auch im Sieg mit beschränkter Durchsetzungskraft leben können. Bei aller Liebe zum Streit, aller Parteilichkeit und Meinungsunterschiede ist die Demokratie auf einen Grundkonsens aller Beteiligten angewiesen, wie die Regeln des Spiels funktionieren und welche Institutionen als Schiedsrichter wirken.
Das alles ist viel verlangt, und darum ist demokratische Politik nichts für jedermann. Wer es hingegen schafft, den Gestaltungswillen durch Selbstbescheidung zu zügeln, die Fähigkeit zur Mehrheitsbeschaffung mit der Akzeptanz des Minderheitendaseins zu verbinden und die Teilhabe am demokratischen Prozess über die Durchsetzung des eigenen Willens setzt, gehört zurecht zur meritokratischen Elite der Demokratie. Jede Demokratie braucht politische Eliten, um funktionieren zu können; keine, auch nicht die schweizerische, entspricht dem Bild einer direkten Volksherrschaft. Was demokratische Eliten auszeichnet, ist die Akzeptanz einer fremdbestimmten Verweildauer an der Macht und die Bereitschaft, bei einer Abwahl neuen Mitgliedern im Kreis der Mächtigen geräuschlos Platz zu machen: «servir et disparaître».
Skizziert man die Grundbedingungen für das Funktionieren von Demokratie, drängt sich heute die Diagnose auf, dass die demokratische Politik in der Krise steckt. Anders als früher wird sie nicht von der Anziehungskraft konkurrierender Systeme wie dem Kommunismus oder Faschismus bedroht. Die Krise hat vielmehr ihr Herz ergriffen: die Streitkultur. Politische Gegner werden zu Feinden erklärt, demokratische Spielregeln verletzt, Kontrollinstanzen ignoriert und sogar Wahlresultate geleugnet.
Am 6. Januar 2021 kam es zum grössten Angriff auf die amerikanische Demokratie in der jüngeren Geschichte: Als Donald Trump seine Anhänger aufforderte, «zum Kapitol zu marschieren», um die angeblich gestohlene Wahl rückgängig zu machen, kündete er den demokratischen Fundamentalkonsens auf. Der Mob, der ins Kapitol eindrang, stürmte nicht nur ein Gebäude, sondern brach mit der Idee, dass politischer Streit durch Worte und Wahlen entschieden wird. Vier Jahre später sitzt jener Mann, der zum Aufruhr anstiftete, wieder im Weissen Haus – gewählt, aber nicht geläutert – und verfolgt eine Politik der ungeteilten Macht.
Auch in Europa zeigen sich Bruchstellen. In Deutschland prägt die «Brandmauer» gegenüber der AfD das politische Klima. Sie steht für den Versuch, die demokratische Ordnung gegen innere Feinde zu verteidigen. Die moralische Grenzziehung ist historisch nachvollziehbar, aber demokratisch heikel: Wo genau verläuft die Grenze zwischen legitimer Abwehr und politischer Ausgrenzung? Wenn demokratische Parteien den Dialog mit einer wachsenden Wählerschaft verweigern, droht die Demokratie, ihr wichtigstes Kapital zu verlieren – die Fähigkeit, Konflikte innerhalb ihrer eigenen Ordnung zu halten. Der Streit, der sie beleben sollte, wird selbst zum Risiko.
Diese Beispiele illustrieren, was die Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt in ihrem viel beachteten Buch «How Democracies Die» (2018) als die schleichende Aushöhlung demokratischer Normen beschrieben haben. Demokratien, so ihre These, scheitern heute selten an Staatsstreichen, Invasionen oder Revolutionen. Sie verfallen leise, von innen heraus – durch den allmählichen Verlust jener Selbstbeschränkungen, die das politische Spiel zusammenhalten. In funktionierenden Demokratien, schreiben Levitsky/Ziblatt, halten sich die Gegner freiwillig an zwei ungeschriebene Regeln: dass der Gegner trotz aller Unterschiede ein legitimer Mitspieler bleibt und dass die eigene Macht nicht bis zum Äussersten ausgereizt werden darf.
Wo diese beiden Regeln erodieren, beginnt die Demokratie zu wanken. Wenn politische Akteure die Opposition als Feind behandeln, Justiz und Medien für parteilich erklären und Wahlen nur noch akzeptieren, wenn sie selbst gewinnen, verliert das System den inneren Halt. Die Institutionen mögen formal weiterbestehen, doch sie werden zu Kulissen eines Machtkampfs ohne Regeln. Der Streit, der einst Ausdruck pluralistischer Vitalität war, kippt in einen Kampf um Sieg oder Vernichtung.
Interessiert, das Thema zu vertiefen? Prof. Caspar Hirschi hält im Herbstsemester 2026 eine öffentliche Vorlesung mit dem Titel «Ist die Demokratie Geschichte? Historische Antworten auf eine drängende Frage». Vom 13. November bis 18. Dezember findet diese jeweils Donnerstags von 18:15 Uhr bis 19:45 Uhr auf dem Campus der Universität St.Gallen (HSG) statt. Für eine Teilnahme ist ein gültiger Semesterpass für das öffentliche Programm erforderlich (Kosten: CHF 20). Alle Infos auf der Website.
Dass Demokratien nicht nur von Gesetzen, sondern von Sitten leben, war schon dem französischen Aristokraten Alexis de Tocqueville bewusst, als er in den 1830er Jahren die Vereinigten Staaten bereiste. In «Über die Demokratie in Amerika» entwarf er das eindrucksvolle Porträt einer Gesellschaft, die Gleichheit und Freiheit miteinander zu verbinden versucht. Tocqueville sah früh, dass Demokratie weit mehr ist als ein institutionelles Arrangement: Sie ist eine Lebensform. Ihre Stärke beruht auf der Bereitschaft der Bürger, sich zu engagieren, Kompromisse zu schliessen, Verantwortung zu übernehmen.
Tocqueville faszinierte an den Amerikanern seiner Zeit, dass sie die Kunst der Selbstregierung täglich einübten – in Vereinen, Gemeinden, Kirchen und Zeitungen. Diese Formen des Zusammenwirkens schufen eine moralische Schule der Freiheit, in der die Gesellschaft sich selbst regulierte. Darin sah er den entscheidenden Unterschied zu den alten Gesellschaften Europas: Die Amerikaner stritten, aber sie taten es in Formen, die sie selbst geschaffen hatten. Der Streit war nicht Zersetzung, sondern Bindung.
Gerade dieser Aspekt scheint heute verloren zu gehen. Die Institutionen bleiben formal intakt, doch die sozialen Orte, an denen Menschen lernen, politisch zu handeln, schwinden. Die neuen Öffentlichkeiten der digitalen Welt verstärken zwar den Streit, aber sie ordnen ihn nicht. Aus Meinungsvielfalt wird Konfrontation, aus Kritik Empörung, aus Teilhabe Erschöpfung. Die Demokratie hat das Streiten nicht verlernt, aber sie hat die Fähigkeit eingebüsst, Streit produktiv zu machen.
Hier liegt der Kontrast zwischen Levitsky/Ziblatt und Tocqueville. Erstere beschreiben, wie Demokratien zerfallen, wenn ihre Institutionen und Normen erodieren; letzterer zeigt, warum sie überhaupt funktionieren, solange sie durch lebendige soziale Praktiken getragen werden. Doch letztlich geht es ihnen um dasselbe Phänomen: das fragile Gleichgewicht zwischen Konflikt und Ordnung.
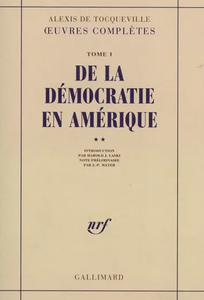
Buch
Wer die Geschichte der Demokratie, die Geschichte Amerikas und die Geschichte des 19. Jahrhunderts besser verstehen möchte, findet in diesem Buch eine Fülle von Anregungen. Tocqueville war ein Aristokrat ohne reaktionäre Allüren, der die Französische Revolution und die Amerikanische Demokratie mit kritischer Distanz analysierte – und dabei besser verstand als die meisten involvierten Akteure. Sein Buch über die Demokratie in Amerika gehört zu den wichtigsten Klassikern der modernen Demokratietheorie.

Buch
Man muss den Pessimismus dieses Buches nicht zwingend teilen, um seine Bedeutung anzuerkennen. Levitsky und Ziblatt argumentieren, dass heutige Demokratien kaum durch Putsche, sondern durch die schleichende Erosion demokratischer Normen zerfallen. Das Buch kontrastiert aktuelle Entwicklungen in den USA mit der Weimarer Republik und autoritären Tendenzen in Lateinamerika – und schärft damit den Blick für die spezifische Lage der Demokratie in der heutigen Zeit.

Buch
Dieses Buch ist das optimistische Gegenstück zu Levitsky und Ziblatt, etwas anspruchsvoller, aber auch origineller. Manow zeigt, wie die Demokratie zugleich offener und verletzlicher geworden ist: Mehr Menschen beteiligen sich direkt, während klassische Institutionen an Bindungskraft verlieren. Viele heutige Krisen entstehen aus inneren Spannungen zwischen Partizipation und Repräsentation. Damit hilft das Buch, den aktuellen Wandel der Demokratie nicht nur als Verfall, sondern auch als Folge ambivalenter Veränderungen zu verstehen.